Persönlichkeiten des Altenburger Landes
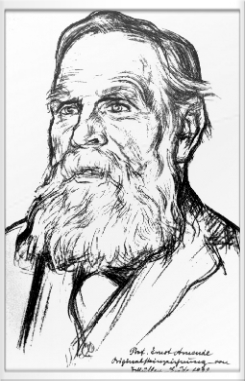
Prof. Ernst Amende
1852-1940
Ernst Amende ist der Sohn eines Schneidermeisters, er wurde am 13. Mai 1852 in Orlamünde geboren. Nach dem Besuch der dortigen Schule kam er 1869 zum Studium an das Altenburger Lehrerseminar. Als Junglehrer geht er von 1872 bis 1874 an die Bürgerschule in Schmölln, danach für zwei Jahre an das Karolinum in Altenburg. Ab 1876 ist er am Altenburger Lehrerseminar selbst als Unterrichtender tätig, insgesamt 43 Jahre bis zu seiner Pensionierung 1919. 1894 war Amende zum Seminaroberlehrer ernannt worden, 1917 verlieh ihm Herzog Ernst den Professorentitel für seine Verdienste um die Bildung der Jugend.
Die ersten wichtigen Artikel von Ernst Amende erscheinen 1900 im Buch „Thüringen in Wort und Bild“, 1997 als Reprint erschienen, darauf folgte 1902 die bereits erwähnte „Landeskunde“. Desweiteren schrieb Amende Beiträge für die „Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle/S.“, für die Sonntagsbeilage der Altenburger Zeitung „Am häuslichen Herd“, allein 47 Beiträge in den „Mitteilungen der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft“ zwischen 1907 und 1932 sowie weitere im „Altenburger Geschichts- und Hauskalender“ der Jahre 1927 bis 1936. Ein wichtiges Werk ist auch die „Vorgeschichte des Altenburger Landes“, 1922 gleichsam als „Führer durch die vorgeschichtliche Abteilung des Altenburger Heimatmuseums auf dem Schloß“ geschrieben. Dort war diese Abteilung von ihm angelegt und geleitet worden, sie beinhaltete nicht nur seine eigenen Funde und Ausgrabungsergebnisse, sondern das gesamte vor- und frühgeschichtliche Sammelmaterial der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft, was mitunter vergessen wird. Die Sammlungen wurden später nach ihm „Ernst-Amende-Sammlung für Vorgeschichte“ genannt. Allein bis 1934 war diese auf 4.576 Inventarnummern angewachsen, wovon heute allerdings nur ein Bruchteil ausgestellt wird.
Über „Schriften von und über Prof. Ernst Amende“ sowie weiteres Interessantes über den bedeutenden Heimatgeschichtsforscher kann man im Band 17, Heft 1 / 2 der „Mitteilungen der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft“ 2002 nachlesen, in diesem Büchlein finden sich die Beiträge heutiger Heimatforscher anläßlich einer Gedenkveranstaltung zum 150. Geburtstag von Ernst Amende.
Abbildung: Repro einer Zeichnung von Ernst Müller-Gräfe 1932
Quellennachweis beim Autor.
Andreas Klöppel (Mai 2017)

Kuno Apel
1902-1983
Kuno Apel wurde am 23. März 1902
in Knau geboren, sein Vater war der dortige Freigutsbesitzer Adolph Apel. Nach
dem Besuch der Grundschule in Zschernitzsch, der Realschule in Altenburg und
der dortigen Reichenbachschule arbeitet er auf dem väterlichen Hof. Frühzeitig
wird sein Interesse für die Heimatgeschichte geweckt, bereits 1922 wird er
Mitglied der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes
zu Altenburg. Schon 1926 hält er dort seinen ersten, später auch gedruckten
Vortarg über die Altenburger Amtsrechnungen. 1928 besucht Apel zum ersten Mal
das Staatsarchiv in Dresden, Archivbesuche in Weimar, Naumburg, Glauchau,
Magdeburg, Ilmenau, Arnstadt, Meuselwitz und sogar München folgen. 1936 ordnet
er die Bibliothek des Herrn von der Gabelentz auf Schloß Poschwitz, außerdem
arbeitet er in vielen Pfarrarchiven des Altenburger Landes, so z.B. Mehna,
Gerstenberg, Tegkwitz, Nobitz, Saara und Ehrenhain. Im Februar 1946 ist Kuno
Apel zum ersten Mal nach dem Krieg wieder im hiesigen Archiv tätig.
Seit 1949 arbeitet Kuno Apel in
der Braunkohle, genauer in Deutzen, doch seine Freizeit nutzt er weiterhin für
die Heimatforschung, so z.B. in der gleichnamigen Fachgruppe innerhalb des
Kulturbundes. Apel erstellt Chroniken von 300 Dörfern, davon 40 ziemlich
komplett. Die Chroniken präsentiert er der Öffentlichkeit zumeist in Form von
Vorträgen, allein zwischen 1924 und 1939 hielt er 34 Vorträge, zwischen 1946
und 1977 insgesamt 81. Obwohl er seine Forschungsarbeiten testamentarisch dem
hiesigen Staatsarchiv übereignete und diese heute für alle interessierten
Forscher uneingeschränkt nutzbar sind, fehlen doch einige seiner auf
Schreibmaschine getippten Vorträge / Chroniken, so z.B. zur Baugeschichte der
Papiermühle in Großstöbnitz. Da diese Texte von Apel mit Durchschlag
geschrieben worden sind, ist es durchaus möglich, das sich solche noch heute in
Gemeinde- oder Privatbesitz befinden. Eine Bibliographie einschließlich der
Liste mit den öffentlichen Vorträgen Apels finden interessierte Leser in den
„Mitteilungen der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft“, Heft 1 /
2 des Bandes 17 von 2002, wo auch die Vorträge des Kolloquiums zum Abdruck
gebracht worden sind.
Zwischen 1922 und 1959
veröffentlichte Kuno Apel Artikel zu heimatgeschichtlichen Themen in den
Altenburgischen Heimatblättern (1922 bis 1940), der Altenburger Landeszeitung
(1923), dem Altenburgischen Sonntagsblatt (1926), der Zeitungsbeilage „Am
häuslichen Herd“ (1932), dem Altenburger Geschichts- und Hauskalender (1941),
dem Kulturspiegel (1956) und dem Heimatkalender (1959). Seine Chroniktexte
finden sich oft in heutigen Dorfchroniken wieder, eine posthume Ehrung für Kuno
Apel, wenngleich es auch schon Fälle ohne seine Nennung als Autor gab. 1983, am
12. Dezember, stirbt Kuno Apel in seinem Heimatort Knau.
Anläßlich des 100. Geburtstages
von Kuno Apel veranstaltete die Geschichts- und Altertumsforschende
Gesellschaft des Osterlandes im Jahr 2002 ein Kolloquium zu Ehren des
bedeutendsten Heimatforschers der jüngsten Vergangenheit. Obwohl dem Autoren
dieser Zeilen eine Begegnung mit ihm versagt geblieben ist, hielt ich dennoch
einen Vortrag über „meine Begegnung mit Kuno Apel“. Wohl kaum ein Thema der
Heimatgeschichte, was er nicht bearbeitet hätte, wohl kaum eine Stadt oder ein
Dorf im Landkreis, über welches es keine zumindest ansatzweise erarbeitete
Chronik von ihm gibt. So ist es nicht verwunderlich, das wohl jeder heutige
Heimatforscher irgendwann Kuno Apel respektive seinen Forschungsarbeiten
begegnet. Apels Stärke liegt in seinen Materialsammlungen, den leider
ungedruckten Vorträgen und Manuskripten sowie seinen stets nach gleichen
Prinzipien erstellten Ortschroniken. Durch die Arbeit mit dem Apelschen Nachlaß
können wir das Entstehen einer Dorfchronik beispielsweise von der
Materiualsammlung bis zum maschinengeschriebenen Manuskript nachvollziehen, dem
Apelschen Prinzip entweder folgen und es ausbauen oder uns dort Anregungen für
das Beschreiten eigener Wege holen.
Abbildung: Repro eines Fotos mit
Apel bei der Arbeit an seiner Kreischronik (Quelle GAGO)
Quellennachweis beim Autor.
Andreas Klöppel (November 2017)
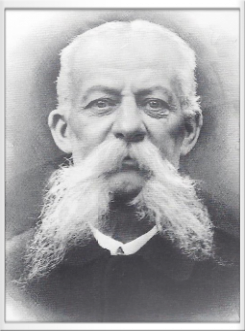
Artur Ernst Glasewald
1861-1926
Arthur Ernst Glasewald wurde am 2. August 1861 in Gößnitz als ältester Sohn des Buchhändlers Arthur Glasewald geboren. Nach Beendigung der Schulzeit ging er bei seinem Vater in die Lehre und lernte Buchbinder. Bis 1880 ging er als Geselle auf Wanderschaft, dann machte er sein Hobby zum Beruf. Bereits als Kind hatte er seine Liebe zu den Briefmarken entdeckt, von seinem Vater, welcher 10 Jahre durch Skandinavien gereist war, hatte er den Grundstock zu einer Sammlung erhalten, erweitert durch amerikanische Briefmarken von seinem dort lebenden Onkel. Also arbeitete Glasewald zunächst von 1880 bis 1883 beim Buchhändler Löwenthal in Kassel in dessen neugegründetem Briefmarkengeschäft. Wohl auf Glasewalds Initiative hin wird 1881 der „Casseler Philatelisten-Club“ gegründet. 1883 geht er als erster gelernter Briefmarkenhändler nach Hamburg zum Markengroßhändler Goldner. 1885 folgt er dem Ruf der Firma J.H. Dauth nach Frankfurt a.M., wo er als Geschäftsführer tätig wird und gleichzeitig die Redaktion der „Frankfurter Briefmarken-Zeitung“ übernimmt.
1886 kehrt A. E. Glasewald in seine Heimat nach Gößnitz zurück und errichtet hier am 15. März d. J. selbst eine Briefmarkenhandlung. Am 3. Dezember 1889 heiratet er Klara Helene Gabler aus Naundorf bei Gößnitz und nur wenige Wochen später, am 29. Dezember 1889, gründet Glasewald den Deutschen Philatelistenverband Gößnitz, in welchem er das Amt des ersten Schriftführers bis zu seinem Tode ausübte. Er war nicht nur Briefmarkenhändler, sondern auch und vor allem ein Sammler und Publizist. Für seine literarischen Verdienste sowie die Verdienste um die Deutschen Philatelistentage erhielt er 1920 die Lindenberg- und 1925 die Hans-Wagner-Medaille. Seine Bedeutung als Philatelist wird u.a. deutlich durch seine Tätigkeit als General- und Spezialprüfer, seit 1899 Leiter und seit 1901 Geschäftsführer der Bundesprüfstelle, wo er als Bekämpfer des Fälschungsunwesen wirkte. Zudem regte er als erster die Ausgabe von Wohlfahrtsmarken an.
Von der ansehnlichen Zahl philatelistischer Werke, deren früheste er übrigens unter Pseudonym veröffentlichte, sollen nur einige wenige genannt werden: „Die Postwertzeichen von Griechenland. Nach den neuesten Forschungen“ 1896, „Die Post im Kriege. Beiträge zur Geschichte der Feldpost“ 1914, Redaktion des „Handbuchs der deutschen philatelistischen Literatur“ 1916, „Handbuch der deutschen Privatpostzeichen“ (unvollständig), und „Thurn und Taxis in Geschichte und Philatelie“ 1926, nach seinem Tode. Dazu kommt noch eine Anzahl von herausgegebenen und redaktionell betreuten Philatelisten-Zeitschriften sowie gedruckte Vorträge in anderen philatelistischen Werken.
Neben der Philatelie gehörte auch die Familienforschung und Heimatkunde zu Glasewalds beliebten Beschäftigungen. Das 1914 auf seine Anregung hin gegründete Heimatmuseum in Gößnitz, dessen Aufsicht er über viele Jahre ehrenamtlich übernahm, verdankt ihm den weitaus größten Teil seiner Bestände und nur die Mitarbeiter des heutigen Heimatmuseums können nachvollziehen, was und wieviel von jener Sammlung die Zeitenwenden überdauert hat und auf uns gekommen ist. Die Familienforschung Glasewalds gipfelten 1908 im Erscheinen des „Stammbuchs des Geschlechts Glasewald“ mit einem Stammbaum. Den Heimatforschern ist A. E. Glasewald als Verfasser der Chronik seiner Vaterstadt bekannt geworden. Seine 1910 im Verlag seiner eigenen Buchhandlung erschienene „Chronik der Stadt Gößnitz“ hat bis heute nichts an Gültigkeit verloren und wurde vor Jahren als Reprint neu aufgelegt. Sie ist noch heute unverzichtbarer Bestandteil jeder heimatgeschichtlichen Bibliothek.
Quellennachweis beim Autor.
Andreas Klöppel (Mai 2017)
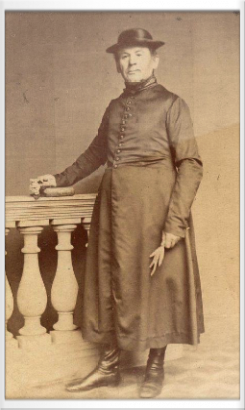
Zacharias Kresse
1800-1876
Als der wohl bedeutendste
Vertreter der Bauernschaft des Altenburger Landes im Jahre 2000 seinen 200.
Geburtstag hätte feiern können, richtete ihm zu Ehren die Geschichts- und Altertumsforschende
Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg, deren Mitglied er zu Lebzeiten war,
ein Symposium aus. Der Autor, welcher seinerzeit zum Thema: „Zacharias Kresse
und die Altenburgische Landwirtschaft“ referierte, möchte diesen nunmehr vor allem
als Heimatforscher vorstellen.
Zacharias Kresse wurde am 21.
Januar 1800 als einziges Kind des Anspanngutsbesitzers Georg Kresse in
Dobraschütz geboren. Nach dem Schulbesuch und dem ersten Mitarbeiten auf dem
elterlichen Hof mußte er diesen bereits im Alter von 22 Jahren wegen des
schlechten Gesundheitszustandes seines Vaters übernehmen. 1823 heiratete Kresse
die 1804 geborenen Christina Köhler aus Kraasa, dem Ehepaar wurden acht Kinder
geboren, von denen zwei bereits im frühen Kindesalter starben. Kresse war ein
vorbildlich wirtschaftender wie auch fortschrittlicher Bauer und es ist
erstaunlich, welche „Projekte“ er neben seiner Arbeit auf dem Hof, neben seinen
Pflichten als Familienvater und vor allem neben seinen politischen Funktionen
verfolgte und verwirklichte. Er war zunächst von 1832 bis 1848, dann erneut von
1850 bis 1857 bäuerlicher Abgeordneter des Altenburger Landtages sowie von 1851
bis 1866 auch Gemeindevorsteher in seinem Heimatdorfe Dobraschütz, unbeachtet
bleiben seine kirchenamtlichen Tätigkeiten. Sein Engagement für die Bildung der
Dorfjugend kommt 1842 mit der Gründung einer Schulbibliothek zum Ausdruck. 1849
hatte er sich dann für den Neubau der Schule im Dorf eingesetzt, diese auch
projektiert. Später errichtete er eine Sonntagsschule für Bauernsöhne in seinem
Hause, wo er selbst die angehenden Landwirte mit den Fortschritten in der
Landwirtschaft vertraut machte. Zacharias Kresse war nicht nur Freimaurer und
als solcher in der Altenburger Loge engagiert, sondern er war auch Mitglied in
mehreren, seinerzeit überaus wichtigen Vereinen, wie dem Altenburger
Landwirtschaftsverein, der bereits erwähnten Geschichts- und
Altertumsforschenden Gesellschaft sowie der Naturforschenden Gesellschaft des
Osterlandes, zudem schrieb er die Witterungs- und Ernteberichte in über 30
Jahrgängen des Sachsen-Altenburgischen Hauskalenders.
Sein dichterisches Können – er
schrieb 332 Gedichte in Hochdeutsch sowie 10 in Altenburger Mundart, unter
ersteren die „Geschichte der Landwirtschaft im poetischen Gewande“ – offenbarte
er bereits 1826 noch anonym mit einem Festgedicht zum Einzug des neuen Herzogs
von Sachsen-Altenburg, Herzog Friedrich aus Hildburghausen. Als Initiator und
Mitorganisator mehrerer Altenburger Bauernreiten hat sich von Zacharias Kresse
ein „Programm zu einem ländlichen Festzug, sowie überhaupt zu einem
landwirtschaftlichen Feste in der Residenzstadt Altenburg“ aus dem Jahre 1846
gedruckt erhalten.
Von den heimatgeschichtlichen
Schriften Kresses sind neben der Zuarbeit zum 1843 erschienenen Buch „Einige
Nachrichten über den Bezirk des Kreismates Altenburg im Herzogtum
Sachsen-Altenburg“ vier wichtige Werke zu nennen. Da ist zunächst die 1845
gedruckt erschienene „Geschichte der Landwirtschaft des Altenburgischen
Osterlandes“ – seinerzeit eine Preisschrift neben jener von William Löbe, heute
ein absolutes Standardwerk, noch vor Jahren eine teure antiquarische
Anschaffung, heute digitalisiert aus dem Internet zu erhalten. Eine Ergänzung, was die Geschichte
der Landwirtschaft betrifft, hinterließ uns Kresse handschriftlich mit dem Werk
„Einige Nachrichten zur Erinnerung an die Vergangenheit und die Gegenwart, aus
authentischen Quellen gesammelt und zusammengestellt von Z.K.“ um 1865. Dieses
Buch enthält neben genealogischen Forschungen auch Historisches zum Dorf
Naundorf sowie den Neubau des Schellenbergischen Gehöftes dort, dessen Bau
unter der Leitung von Zacharias Kresse erfolgte. Ein über 600 Seiten starkes
Buch, ebenfalls handschriftlich aus seiner Feder erzählt „Die Geschichte des
Dorfes und der Flur Dobraschütz über den Zeitabschnitt 1525 bis 1860“ und ist
der exzellente Prototyp einer Dorfchronik. Mit seiner Autobiographie, welche
Kresse nur zwei Jahre vor seinem Tod fertigstellte, gibt er uns Nachgeborenen
einen Einblick in das politische, soziale, gesellschaftliche und kulturelle
Leben seiner Zeit: „Geschichte des Lebens und Schaffens sowie einige sonstige
damit verbundene Ereignisse“, 1874, über 500 Seiten und 1981 in 500 Exemplaren gedruckt
im Eigenverlag von der damals in der BRD ansässigen Bundeslandsmannschaft
Thüringen, Kreisheimatbetreuer für Altenburg Stadt und Land, unter dem Titel
„Lebenschronik des Altenburger Bauern Zacharias Kresse aus Dobraschütz 1800 –
1876“. Glücklich kann sich wähnen, wer ein Exemplar jenes Druckerzeugnisses durch
Verwandte oder Bekannte über die Staatsgrenze der DDR geschmuggelt bekommen
hat.
Als weiterführende Literatur über
Zacharias Kresse, welcher am 1. Oktober 1876 verstarb, seien folgende
Publikationen genannt: 1. Die 8teilige Artikelserie in der OVZ aus dem Jahre
1993 von Dr. Günter Hauthal „Zacharias Kresse – Chronik des außergewöhnlichen
eines Bauern“, welches sich vor allem auf die oben erwähnte Lebenschronik
stützt und diese auswertet. 2. Die „Mitteilungen der Geschichts- und
Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes“, 16. Band, 4. Heft, welches
die Beiträge des Kresse-Symposiums aus dem Jahr 2000 enthält. 3. „Osterländer –
Eigentümliche Geschichte/n aus einem verschwiegenen Landstrich“ von Christian
Berg aus dem Jahre 1995, wozu der Autor des Beitrags seinerzeit bereits eine
Rezension geschrieben hat.
Abbildung: Repro eines
historischen Fotos von Zacharias Kresse.
Quellennachweis beim Autor.
Andreas Klöppel (Oktober 2017)
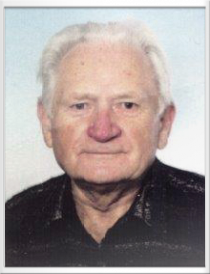
Hans-Joachim Müller
1922-2001
Gesehen hatte der Autor dieser Zeilen den freundlichen älteren Herrn bei seinen Besuchen im hiesigen Staatsarchiv schon, allein dessen Beitrag in einem Heimatkurier des Jahres 1992 unter dem Titel „Eine alte schöne Sitte im Altenburger Land“, in dem es um Dorfzimmerleute und Hausinschriften ging, und die darauf folgenden Gespräche dazu brachten mir seine persönliche Bekannt- und Freundschaft.
Am 21. Juli 2001 verstarb 79jährig der vor allem durch seine historischen Beiträge zu Wintersdorf, Gröba und Umgebung hier auf der Heimatgeschichte-Seite bekannte Heimatforscher Hans-Joachim Müller. Er war am 24. Juni 1922 in Leipzig-Volkmarsdorf geboren worden und ab Ostern 1929 ging er in Wintersdorf zur Schule, weil die Familie in das Gärtnergut seiner Großeltern auf dem Gröbaer Angerberg eingezogen war. Nach Volksschule und Lehre in der Wintersdorfer Gemeindeverwaltung wird er 1939 dort als Angestellter übernommen. 1941 muß er in den Krieg, aus welchem er erst 1947 zurückkehrt. Er heiratet in selben Jahr und zieht 1948 nach Gröba in das Haus seiner Eltern. Es folgen die Jahre der Arbeit in der Braunkohle, ab 1952 ist er in der Verwaltung des Braunkohlenwerkes Rositz tätig. Mit Abendschul-Qualifikation und Abendschulstudium schafft er es dort zum Ingenieur-Ökonom. Bis zum Eintritt ins Rentenalter und dem damit verbundenen Beginn intensiver Forschungen zur Heimatgeschichte, vor allem nach dem Umzug nach Altenburg, bleiben Hans-Joachim Müller noch Jahre glücklichen Familienlebens, dem Schaffen an Haus und Hof in Gröba, und dann bereits als Rentner der Genuss der ersten Opafreuden.
Quellennachweis beim Autor.
Andreas Klöppel (Mai 2017)

Heidrun Nitzsche
1946-2013
Am
6. Januar 2013 verstarb die Heimatgeschichtsforscherin Heidrun Nitzsche aus
Maltis an einer heimtückischen Krankheit. Wer sie kannte, weiß, dass mit ihrem
Dahinscheiden nicht nur ihre Familie
einen unwiederbringlichen Verlust an menschlicher Wärme, Liebe und Fürsorge
erlitten hat, mit ihr verlor auch die „Zunft“ der hiesigen Heimatforscher eine
ihrer wichtigsten Mitstreiterinnen bei der Aufarbeitung und Interpretation der
Geschichte der Dörfer des Altenburger Landes.
Da
kennt man sich schon so viele Jahre, es war, so glaube ich mich zu erinnern,
das Jahr 1998, als der Autor dieser Zeilen sie das erste Mal in der Saaraer
Gemeindebibliothek, welche sie damals betreute, besuchte. Über die Jahre hat
man sich neben der heimatgeschichtlichen Fachsimpelei auch gern über die
Familie unterhalten, ja diese auch bei Besuchen kennengelernt, aber beim
Niederschreiben eines gedenkenden Artikels merkt man doch, wie wenig
Biographisches man letztlich voneinander weiß. Deshalb dankt der Autor an
dieser Stelle der Familie Nitzsche für die Informationen zu einem kurzen
Lebenslauf von Heidrun Nitzsche. Sie wurde am 16. Juni 1946 als Tochter des
Landarbeiters Gustav Wöffen in Großstöbnitz geboren, dort wuchs sie auf und
besuchte die Schule. Von 1963 bis 1965 absolvierte sie die Lehre und arbeitete
dann bis 1967 als Verkäuferin. 1966 heiratete sie ihren Ehemann Günter Nitzsche
aus Maltis, wo sie mit ihm ein Seitengebäude des früher Pfefferkornschen Hofes
zu einer Heimstatt ausbaute und den unter Denkmalschutz stehenden Hof als
Kleinod erhielt. Zur Betreuung ihrer Kinder Anett und Mirko blieb sie die
ersten Jahre zu Hause in Maltis und entschloss sich 1972 zur Heimarbeit für die
Firma Puppen-Berger, später VEB Famos Leipzig. Diese Arbeit leistete sie bis
1991, dann gab es den Betrieb nicht mehr. Von 1992 bis 1993 war Heidrun
Nitzsche in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme beim Landratsamt in der Unteren
Denkmalschutzbehörde beschäftigt. Das trug mit großer Sicherheit dazu bei, sie
für die Thematik Heimatgeschichte zu sensibilisieren. Ab 1997 war sie auf der
Gemeinde Saara in verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen angestellt,
darunter die Betreuung der Gemeindebibliothek, was ihr übrigens mit großem
Engagement gelungen ist, sowie die Fortführung der Anfang der 90er Jahre
begonnenen Chroniken der zur Gemeinde Saara gehörenden Orte. Diese Aufgabe
erfüllte Heidrun Nitzsche bis zum Ausbruch ihrer Krankheit, die vielen Beiträge
im Saaraer „Landboten & Gemeindeblatt“ sind dafür beredtes Zeugnis; wir
werden darauf zurückkommen. 2006 wurde Heidrun Nitzsche Rentnerin, die
Möglichkeit eines Zuverdienstes nutzte sie stundenweise in der beliebten
Gemeindebibliothek.
Seit
2005 war Heidrun Nitzsche Mitglied in der Geschichts- und Altertumsforschenden
Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg, dorthin hatte sie bereits einige
Jahre gute Kontakte geknüpft. Zudem engagierte sie sich beim hiesigen
Arbeitskreis für Familienforschung, deren Veranstaltungen sie regelmäßig
besuchte. Die Unterstützung von suchenden Familienforschern war für sie durch
die Kenntnis der Kirchenbüchern des Kirchspiels Saara eine
Selbstverständlichkeit, oft genug wurden deshalb jene durch den Pfarrer an
Heidrun Nitzsche verwiesen.
Ein
besonderes Engagement muß Heidrun Nitzsche in ihrer langjährigen Funktion im
Gemeindekirchenrat von Maltis beschieden werden. Hier wage ich zu behaupten,
dass die Kirche – ein Kleinod inmitten eines alten Bauerndorfes – ihr heutiges Antlitz,
vor allem in der kulturhistorisch
wertvollen Innenausstattung jenen Bemühungen von Heidrun Nitzsche, welches auf
ihren starken Glauben und ihre Herzenswärme zurückzuführen sind, zu verdanken
hat. In den Jahren seit 2000 wurden in der Maltiser Kirche u.a. das Gemälde mit
dem lebensgroßen Bildnis des einstigen Maltiser Pfarrers Cornelius Vogel
restauriert (2000), dann das Epitaph, der Taufengel, die Kanzel (2002), der
Taufstein (2006), die Poppe-Orgel (2003-2006), die bemalte Tür zur Sakristei,
die Deckenmalereien. An Außenarbeiten waren das Baumaßnahmen am Dach, Turm,
Laterne, Haube, Bekrönung und dem Westgiebel (2009). Bei all diesen Arbeiten
kümmerte sich Heidrun Nitzsche um die Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Ämtern, den Baufirmen und Restauratoren, sie schrieb u.a. die Anträge für die
Fördermittel, organisierte Spendengelder, gestaltete in ihrem Hof die
Bauarbeiterbetreuung und kontrollierte letztlich auch die Durchführung der
Arbeiten. Rückhalt und Unterstützung hatte sie dafür bei ihrer Familie, mit der
sie nicht nur die allgemeinen Malerarbeiten in der Kirche ausführte, sondern zu
den Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen wie hohen Fest- und Feiertagen
auch die Kirche mit Blumen aus dem eigenen Garten schmückte. Ihr ist
letztendlich auch die Namensgebung der Kirche nach der Heiligen Anna zu
verdanken, aus welchem Anlaß sie eine Ansichtskarte gestaltete. Sie machte
interessante Kirchenführungen z.B. zum Tag des offenen Denkmals und anläßlich
touristischer Besuche im Ort, zudem organisierte sie Orgelkonzerte.
Zwei
Jahre nach der Bildung der Großgemeinde Saara erschien durch die Gemeinde die
erste größere Publikation mit Heidrun Nitzsche als Autorin und Fotografin. Im
Heft „Saara – Eine Gemeinde im Altenburger Land“ stellte sie alle 24 dazugehörigen
Orte in Wort und Bild vor. Fotografieren war eine ihrer Leidenschaften und für
ihre „gute Gesamtleistung“ erhielt sie 2002 beim 6. Fotowettbewerb der
Osterländer Volkszeitung den Sonderpreis. Im Dezember 1999 gestaltete Heidrun
Nitzsche gemeinsam mit Thomas Hummel im ehemaligen Klassenzimmer der damals
100jährigen Schule anläßlich der Festwoche zur Jahrtausendwende eine
sehenswerte wie unterhaltsame Ausstellung unter dem Thema „Unser Dorf – von
früher bis heute“. Viele Bürgerrinnen und Bürger aus den Orten der Gemeinde
unterstützten sie dabei gern mit historischen Dokumenten und Fotografien sowie
Ausstellungsstücken. Eine weitere Ausstellung gelang ihr 2006 zur 750Jahr-Feier
in Taupadel, zu welcher sie auch mehrere Ansichtskarten gestaltete. 2006 brachte
sie mit dem Sell-Heimatverlag in
Altenburg eine Chronik zum 75jährigen Jubiläum der Bornshainer Feuerwehr
heraus. Im gleichen Jahr wurde Heidrun Nitzsche für ihre Arbeit als Chronistin
durch den Bürgermeister im Rahmen einer ersten Ehrung für ehrenamtliche
Tätigkeit ausgezeichnet, zudem erhielt sie kurz darauf die Ehrenamtscard des
Landkreises.
Dem
Autor der Zeilen ist es wichtig, noch einige Bemerkungen zum
heimatgeschichtlich-literarischen Nachlaß von Heidrun Nitzsche zu machen. Dem
Leser des Geschichts- und Hauskalenders sind ihre Beiträge in neun Jahrgängen
zwischen 2000 und 2009 mit Sicherheit noch hinreichend bekannt, für die
Bauernhofbilder-Kalender des E.Reinhold-Verlages schrieb sie in den Jahren 2004
bis 2007 Beiträge zu Bauernhöfen in sechs Dörfern. Auf der
Heimatgeschichte-Seite der Osterländer Volkszeitung erschienen 2006 von ihr 20
Artikel, dazu im gleichen Jahr eine Artikelserie in der Ostthüringer Zeitung
zur Kirchengeschichte von Saara. Die meisten Beiträge von Heidrun Nitzsche zu den
unterschiedlichsten heimatgeschichtlichen Themen wurden im Gemeindeblatt von
Saara veröffentlicht, in den Jahren zwischen 1998 und 2010 waren das insgesamt
mindestens 111. Von den 24 Dörfern wurden dabei lediglich vier Orte nicht mit
Einzelbeiträgen bedacht. Neben Themen wie Familien- bzw. Hofgeschichte schrieb
sie solche zu dörflichen Vereinen, der Feuerwehr, zur Kirchengeschichte,
Mühlen- und Rittergutsgeschichte, zu Gasthöfen und anderen ländlichen Gewerben,
zu Schulen und Kindergärten, über Gemeindeordnungen, Brände, Ersterwähnungen
der Orte, aber auch zu Flurnamen,
Grabdenkmalen, der Flößerei, der Auswanderung von Landeskindern nach
Amerika, zur Mundart, zum Brauchtum im Jahresverlauf und den verschiedenen bäuerlichen
Festlichkeiten.
Bei
ihren Recherchen stützte sich Heidrun Nitzsche vor allem auf Originalakten der
hiesigen Archive – dem Kreisarchiv beim Landratsamt und dem Thüringer
Staatsarchiv, dann dem Kirchenarchiv von Saara. Dazu kam ein intensives Studium
der heimatgeschichtlichen Literatur, die Befragung von Zeitzeugen und der
Gedankenaustausch mit anderen Heimatforschern. Bei letzterem wird ihrer gern
gedacht, dennoch wird sie uns immer fehlen. Auch wenn sie es nun selbst nicht
mehr erleben kann, zu wünschen wäre in ihrem Interesse die Publikation einer
neuen Geschichte der von ihr so geliebten Maltiser Kirche mit den 172
Engelsdarstellungen.
Quellennachweis beim Autor.
Andreas Klöppel (Oktober 2014)
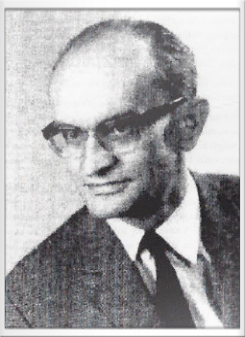
Hans Patze
1919-1995
Jedem Heimatforscher /
Ortschronist, welcher sich mit der Ersterwähnung seines Heimatdorfes befasst,
ist der Name Hans Patze ein Begriff. Stammt von jenem doch der 1953 in den
„Blättern für Deutsche Landesgeschichte“ (Band 90) abgedruckte Artikel: „Zur Geschichte
des Pleißengaus im 12. Jahrhundert auf Grund eines Zehntverzeichnisses des
Klosters Bosau (bei Zeitz) von 1181/1214“. In diesem Zehntverzeichnis findet
man die urkundliche Ersterwähnung von gut 180 Orten des Altenburger Landes. Die
Enstehung des undatierten Verzeichnisses wurde von Patze mit den beiden
Jahreszahlen 1181 und 1214 eingegrenzt und gibt damit mehrere Möglichkeiten,
die Ersterwähnung zu feiern. Seit Patzes Veröffentlichung hat sich meines
Wissens noch kein Wissenschaftler erneut mit einer differenzierteren Datierung des
Dokumentes zu Wort gemeldet.
Hans Patze war am 20. Oktober
1919 in Pegau geboren worden, besuchte dort die Schule, dann das Gymnasium in
Leipzig, wo er 1938 sein Abitur machte. Er studierte anschließend Geschichte,
Kunstgeschichte, Germanistik und Latein in Frankfurt am Main und Jena, ging
1946 als Archivar in Weimar in den thüringischen Archivdienst, war von 1949 bis
1952 Leiter des Landesarchivs Altenburg. Anschließend daran war er in Gotha
tätig, bis er 1956 mit der Familie die DDR verließ. Zunächst hatte er eine
Lehrtätigkeit in Marburg und ab 1963 in Gießen, wo er Professor wurde. 1969
wechselte er nach Göttingen an den Lehrstuhl für niedersächsische
Landesgeschichte, 1985 zog er sich aus gesundheitlichen Gründen aus der aktiven
Wissenschaft zurück, 1995 starb er am 19. Mai in Göttingen.
Bei der notwendigen Aufzählung
wichtiger Schriften bleiben wir bei jenen von Bedeutung für die thüringische
Geschichte sowie für unser Altenburger Land: Die Doktorarbeit Patzes hatte „Die
Zollpolitik der Thüringischen Staaten 1815 bis 1833“ zum Thema, er verteidigte
diese 1947 bei Willy Flach in Jena. Seine Assessorarbeit hatte er über „Recht
und Verfassung thüringischer Städte“, genauer die Städte des ehemaligen
Herzogtums Sachsen-Altenburg, geschrieben, welche 1955 als Buch veröffentlicht
worden ist. Ebenso erschien in diesem Jahr als Edition der erste Band des
„Altenburger Urkundenbuches“ als „entscheidende Grundlage für die Erforschung
der mittelalterlichen Geschichte dieses Raumes, darin behandelt er auch die
Frage der Urkundenfälschungen des Bergerklosters“. Eine wunderbare Übersicht
über das „Altenburger Urkundenbuch“ verfaßte Rudolf Gerlach 1955 in seiner
Rezension für das Dezemberheft des Altenburger Kulturspiegels. Patzes handschriftlich
im hiesigen Staatsarchiv vorliegender Band 2 des „Altenburger Urkundenbuches“
1438 – 1507 harrt noch der posthumen Veröffentlichung, eine nicht nur
wünschenswerte, sondern im Interesse der Heimatgeschichte erforderliche Sache,
derer sich die entsprechenden Stellen annehmen sollten. Die
Habilitationsschrift Patzes „Die Entstehung der Landesherrschaft in Thüringen“
wurde 1962 veröffentlicht in den „Mitteldeutschen Forschungen“ Band 22. Seine
Pegauer Heimat bedachte er 1963 mit der Abhandlung „Die Pegauer Annalen, die
Königserhebung Wratislavs von Böhmen und die Anfänge der Stadt Pegau.“ 1965
erschien in der genannten Reihe als Band 32 die „Bibliographie zur
thüringischen Geschichte“, 1967 im Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und
Ostdeutschlands Band 15 der Beitrag „Zur Geschichte der Landesarchive Altenburg
und Gotha“, 1968 der Band Thüringen des „Handbuches der Historischen Stätten
Deutschlands“ (Band 9). Gemeinsam mit Prof. Dr. Walter Schlesinger brachte
Patze von 1967 bis 1984 die 9 Bände „Geschichte Thüringens“ heraus. Für unser
Altenburger Land ist zuletzt noch das 1976 erschienene Werk Hans Patzes
„Rechtsquellen der Städte des ehemaligen Herzogtums Sachsen-Altenburg“
relevant, es kam ebenfalls in der Reihe „Mitteldeutsche Forschungen“ heraus
(Band 79).
Wer mehr über Patze erfahren
möchte, dem empfiehlt der Autor das Werk: „Wiprecht – Beiträge zur Geschichte
des Osterlandes im Hochmittelalter“, herausgegeben vom Heimatverein des Bornaer
Landes 1998 und erschienen im Sax-Verlag Beucha. Es enthält u.a. auch ein
umfangreiches Schriftenverzeichnis des Historikers.
Abbildung: Hans Patze, Repro
Quellennachweis beim Autor.
Andreas Klöppel (Oktober 2017)
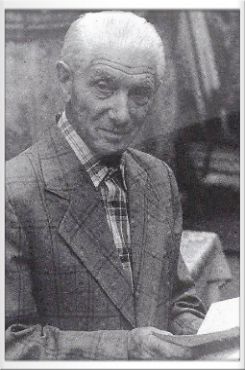
Walter Rabold
1903-1984
Dem Heimatforscher,
Bodendenkmalpfleger und Naturschützer Walter Rabold, dessen Name seit 1991 auch
eine Straße in seiner Heimatstadt trägt, widmete der Gößnitzer Heimatverein 2013
eine Sonderausstellung aus Anlaß des 110. Geburtstages. Generationen von
Gößnitzer Schülern werden sich noch an ihren Biologielehrer erinnern. So soll
auch in diesem Rahmen an Walter Rabold erinnert werden.
Walter Rabold wurde am 5. August
1903 als Sohn des Steinbildhauers Emil Rabold in Langenwetzdorf bei Greiz
geboren. Er war der älteste von drei Söhnen einer gutbürgerlichen Familie. Nach
dem Besuch der Volksschule ging Walter Rabold, dem Wunsch des Vaters
entsprechend, an das Lehrerseminar nach Schleiz. 1924 trat er den Schuldienst
als Lehramtsanwärter in Rudolstadt an. Seit 1925 war er dann in unserem
Heimatkreis aktiv: Bis 1932 arbeitete er an der Schmöllner Volksschule, dann
wurde er nach Gößnitz versetzt, wo er als Biologielehrer tätig war und bis an
sein Lebensende auch wohnte.
Vom Januar 1935 bis August 1939
gab Walter Rabold das Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft für
Heimatforschung und Heimatpflege „Volkstum und Heimat“ als Beilage zum
Gößnitzer Tageblatt heraus. Hier kamen seine ersten heimatgeschichtlichen
Forschungsergebnisse zum Abdruck. Eine schöne Abhandlung über die
„Siedlungsgeschichtliche Entwicklung der Stadt Gößnitz“ schrieb er 1938 für die
„Altenburger Heimat-Blätter“.
Während einer Exkursion der
Altenburger Naturforschenden Gesellschaft 1937 lernte er seine spätere Frau
Marianne, geb. Frühauf aus Elsterberg im Vogtland kennen, 1939 war Hochzeit und
1941 wurde die Tochter Heidi geboren. Nach dem Krieg beteiligte sich Walter
Rabold aktiv am Wiederaufbau in unserem Teil Deutschlands, 1946 gründete er die
Gößnitzer Volkshochschule und 1947 war er Mitbegründer des Kulturbundes in
Gößnitz. Bis zu seinem Wiedereinsatz als Lehrer 1950 arbeitete Walter Rabold
als Dreher und später im Gößnitzer Archiv.
Im Kulturbund und der URANIA
hielt er Lichtbildervorträge zu den Themen seiner Forschungen; diese reichten
von der Beschäftigung mit sorbischen Ortsnamen, Bräuchen und Sagen unserer
Heimat, Wüstungen, die Erforschung vorgeschichtlicher Siedlungen bis hin zu
Beiträgen über die historische Ortsstruktur von Gößnitz. Er veranstaltete
natur- und heimatkundliche Wanderungen, organisierte Ausstellungen und schrieb
heimatgeschichtliche wie auch naturkundliche Beiträge in verschiedenen
Zeitschriften. Zu letzterem seien die „Heimatkalender der Kreise Altenburg und
Schmölln“ der Jahrgänge 1958, 1960 und 1962 genannt, zudem gibt es eine Anzahl
von Artikeln in den damals bekannten und beliebten „Kulturspiegeln“. Im Buch
„Ein historischer Überblick – Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Schmölln“
1957 sind folgende Beiträge von Walter Rabold: Vor- und Frühgeschichte unseres
Kreises, Die frühdeutsche Zeit, Drangsale und Leiden unserer Heimat im
Siebenjährigen Krieg. Seiner Tätigkeit als Leiter der Arbeitsgemeinschaft
„Junge Naturschutzhelfer“ verdanken wir den Naturlehrpfad „Gößnitz-Süd“ im
Pleißental. Auf seine Initiative ist die Bestätigung der Flächennaturdenkmale
„Roter Berg“ bei Zehma, „Nörditzer Heide“, „Nörditzer Schlucht“ und
„Erlensumpfmoor“ bei Gößnitz sowie des Naturschutzgebietes „Brandrübeler Moor“
durch den seinerzeitigen Rat des Kreises erfolgt. Walter Rabold wirkte
verantwortungsvoll als Kreispilzberater und war als passionierter Pflanzen- und
Tierkenner weit über die damaligen Kreisgrenzen hinaus bekannt und gefragt.
Seine bodendenkmalpflegerischen Sammlungen sind heute Bestandteil der
Sammlungen des Museum Burg Posterstein, sie bestehen in vor- und
frühgeschichtlichen Bodenfunden, Berichten, Zeichnungen und Grabungstagebüchern.
Bei allem Zeitaufwand fur Beruf
und Berufung fand Walter Rabold noch Zeit für ein harmonisches Familienleben
und bezog seine Frau in die Forschungstätigkeit ein. Zu den vielen Neigungen
gehörte auch das Verfassen von Gedichten zu Familienjubiläen, über Ereignisse
des täglichen Lebens oder Personen aus dem Freundeskreis. Nachgewiesen sind
übrigens auch Dichtungen seinerseits in Altenburger Mundart. Zu seinem 80.
Geburtstag 1983, gleichsam als Leitmotiv für sein erfülltes Leben, verfaßte er
folgende Zeilen: „Entdecken, forschen, Neues finden, / Unbekanntes zu
ergründen, / wissenschaftlicher Gewinn / gab dem Alltag rechten Sinn.“ Nach
wenigen Wochen Krankenlager verstarb Walter Rabold am 20. Dezember 1984.
Quellennachweis beim Autor.
Andreas Klöppel (Mai 2017)
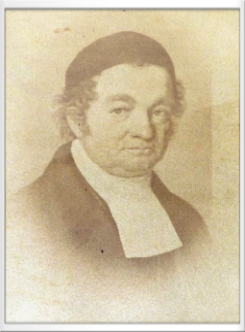
Dr. Christian Friedrich
Heinrich Sachse
1785-1860
Christian Friedrich Heinrich Sachse wurde am 2. Juli 1785 in Eisenberg geboren, sein Vater war dort Kantor und Tertius (Angehöriger der Leitung einer höheren Schule) am Lyceum. Zunächst vom Vater selbst unterrichtet ging Sachse ab 1799 auf das Gymnasium. Sachse studierte von 1804 bis 1807 Theologie an der Jenaer Universität, 1807 besteht er sein Kandidaten-Examen in Altenburg und wird daraufhin zunächst Hauslehrer auf dem Rittergut Kleinlauchstädt bei Merseburg. In Merseburg tritt er 1809 der dortigen Freimaurerloge bei, 1823 dann auch der Altenburger. 1812 wird Sachse Diakon in Meuselwitz, 1823 heiratet er, von seinen 9 Kindern überlebte ihn nur eines. Nach bestandener Gastpredigt wird Sachse 1823 Hofprediger in der Altenburger Schloßkirche, welche Funktion er 37 Jahre lang inne hat. 1831 ist Sachse Consistorial-Assessor (Kirchenrat-Beisitzer), 1833 Consistorialrat, 1841 erhält er die Doktorwürde durch die theologische Fakultät der Jenaer Universität. 1852 wird Dr. Sachse das Ritterkreuz des Ernestinischen Hausordens und der Hannoversche Guelphenorden (von Welfen, Auszeichnung im Königreich Hannover bis 1866) verliehen. Am 9. Oktober 1860, nachdem er krankheitshalber in den Ruhestand gegangen war, stirbt Sachse in Altenburg, die Großfürstin Alexandra von Rußland, eine geborenen Prinzessin von Sachsen-Altenburg, stiftete ein weißes Marmorkreuz für seine Grabstätte auf dem hiesigen Friedhof. Ob es die Grabstätte von Dr. Sachse allerdings noch gibt, vermag der Autor leider nicht zu sagen.
Erste größere poetische Sachen schrieb Sachse anläßlich des 300jährigen Jubiläums der Reformation, im Verein mit Diakonus Mörlin veröffentlichte er 1817 eine Sammlung von Gedichten unter dem Titel „Jubellieder auf das Reformationsfest“. 1822 erscheint von ihm eine „Sammlung christlicher Gesänge zum Gebrauch bei Beerdigungen und bei der Todtenfeier“. Eine kleine Auflage von 21 Predigten als „Predigten, gehalten in der Herzoglichen Schloßkirche zu Altenburg, Eine Gabe für Freunde, die sie gewünscht“ erfolgt 1842. Sieben Lieder schrieb Sachse auch für das Altenburgische Landesgesangbuch, so z.B. Nr. 170 und 543. Seine weltlichen Lieder und Gedichte wurden allerdings erst nach seinem Tode veröffentlicht, 1861.
Christian Friedrich Heinrich Sachse war nach zeitgenössischen Einschätzungen ein „tüchtiger Geschichtsforscher“ und „vorzüglicher Kenner der Reformations- und Kirchengeschichte Sachsens“. 1826 schrieb er, allerdings noch anonym, über „Die Fürstenhäuser Sachsen-Altenburg. Ein historischer Abriß, mit Rücksicht auf die Altenburgische Landesgeschichte überhaupt“. Das Buch erschien anläßlich der ernestinischen Erbteilung und Neugründung des Hauses Sachsen-Altenburg im Jahr 1826. Von 1834 bis 1854 redigierte er den „Herzogl. Sachsen-Altenburgischen vaterländischen Geschichts- und Hauskalender“.
Sachse`s bedeutendstes heimatgeschichtliches Werk besteht in der Herausgabe der zweibändigen „Kirchen-Galerie des Herzogthums Sachsen-Altenburg“, noch heute eines der wohl meist verwendeten und zitierten Quellen, Einstiegsliteratur für jeden heutigen Heimatgeschichtsforscher. Die wichtigste Voraussetzung für dieses Werk hat Sachse in seiner Funktion als Kirchenrat in Altenburg selbst mit geschaffen: Das Konsistorium erließ unter dem 16. Mai 1838 ein Regulativ zur Führung von Ortschroniken durch die Geistlichen im Herzogtum. Sachse hatte nicht nur die Redaktion der Kirchengalerie unter sich, er schrieb auch einige wichtige Artikel für das Werk: die kirchlich-statistische Übersicht des Herzogtums Sachsen-Altenburg, den Absatz mit den Biografien der Altenburger Genearlsuperimtendenten, die Artikel zu den Städten Meuselwitz und Schmölln. Die Bände der „Kirchen-Galerie“, genauer Titel: „Die Ephorien Altenburg und Ronneburg als erste Abteilung der Kirchen-Galerie…“ und „Die Ephorien Eisenberg, Kahla und Roda als zweite Abteilung …“, sind „ein vorzügliches Werk, das Zeugnis von seiner (also Sachse`s) gründlichen Kenntnis der Geschichte unseres Landes ablegt.“ Übrigens gab es nicht nur den Altenburger Band als Reprint, beide Bände sind durch die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek digitalisiert, siehe unter wikisource Sachsens Kirchen-Galerie.
Abbildung: Repro eines historischen Fotos vom Hofprediger Dr. Sachse
Quellennachweis beim Autor.
Andreas Klöppel (November 2017)
Dr. Hans Schobert
1883-1938
Hans Schobert wurde am 24.
Oktober 1883 in Gößnitz geboren, er ist der Sohn des damaligen Gößnitzer
Postmeisters. Seine Reifeprüfung bestand er 1904 auf dem Leipziger König
Albert-Gymnasium. Danach ging er zunächst nach Bonn, um sein Theologie- und
Philosophie-Studium zu beginnen, welches er in Leipzig fortsetzte und 1910 dort
abschloss. Seine theologischen Prüfungen bestand Hans Schobert 1911 und 1912 in
Leipzig und Altenburg. Im August 1913 heiratete er und trat im Oktober d. J.
die Stelle als Pastor in Schmölln an, 1917 wurde er Pfarrer in Flemmingen. Er
blieb im Altenburger Land bis 1928, wo er von Flemmingen aus ins Sächsische ging,
wahrscheinlich nach Leipzig, wo sich für den Autoren die Spuren verlieren.
Lediglich das Sterbejahr – 1938 – konnte der Autor über das Pfarrerbuch Sachsen
online erfahren.
Sein Interesse für die Geschichte
führte zu entsprechenden Studien, welche er 1923 mit einer Dissertation über
„Die innerkirchlichen Zustände Spaniens am Anfang des 4. Jahrhunderts nach den
Canones der Synode von Elvira dargestellt, erläutert und beurteilt“ an der
Hohen theologischen Fakultät Leipzig abschloss. Danach erfüllte er sich den
langgehegten Wunsch, sich mit Archivalien zur Geschichte der engeren Heimat
Altenburg zu beschäftigen. Seine Forschungen in den Staatsarchiven Altenburg,
Dresden und Weimar gipfelten in einer Dissertation zur Erlangung der
Doktorwürde an der Hohen philosophischen Fakultät der Universität Leipzig. Die
1925 von Hans Schobert vorgelegte Arbeit wurde leider nie gedruckt, ist nur als
maschinenschriftliches Exemplar überliefert und wohl auch deshalb von der
jüngeren Geschichtsforschung zu Unrecht viel zu wenig beachtet. Das Thema der
Dissertation lautet: „Das kursächsische Amt Altenburg nach einem Erbbuch von
1548 und den Amtsrechnungen von 1537 – 46“.
Zunächst möchte der Autor auf den
Inhalt des 137seitigen Werkes eingehen: In der Einleitung beschreibt Schober
seine verwendeten Quellen, als das Amtserbbuch und die Amtsrechnungen, dann die
räumliche Ausdehnung des Altenburger Amtes in der Mitte des 16. Jahrhunderts.
Der folgende erste Teil beschäftigt sich mit dem Verwaltungspersonal – Amtmann,
Schosser, Schreiber, Landsknechte, Hofmeister, Geleitseinnehmer und
Förster, dem amtlichen Rechnungswesen
sowie den Einnahmen und Ausgaben des Amtes, z.B. aus dem Geleit, dem
Eigenbesitz wie Forst, Teiche und Vorwerke, dem Gerichtsbetrieb, der Lehnware,
dem Geschoss und den Zinsen sowie bei den Ausgaben u.a. dem Haushalt auf dem
Schloss. Der zweite Teil der Arbeit beinhaltet Probleme der Amtsverfassung: 1) die
Grund- und Lehnsherrschaften im Amt (geistlich, ritterlich, amtlich) und deren
Verteilung in den einzelnen Orten, 2) die grund- und lehnsherrlichen Rechte wie
Lehnware, Zinsen und Frondienste, 3) die gerichtsherrlichen Rechte als Ober-
und Erbgerichtbarkeit in Dorf und Flur und die Organisation des ländlichen
Gerichtswesens, wie z.B. das Dorfrichteramt und der Dingstuhl, 4) die
landesherrlichen Rechte wie Steuer und militärisches Aufgebot und 5) die
ländliche Kirchenorganisation, dabei die Parochialverfassung und das Einkommen
der Pfarrer. Als eine der wichtigen Quellen wurde die Arbeit Schoberts von der
Historikerin Brigitte Streich für ihr Buch „Das Amt Altenburg im 15.
Jahrhundert“ (2000) verwendet, wobei ihr bei der Quellenangabe mehrfach falsche
Jahreszahlen für das Amtserbbuch 1548 unterkommen (1542, 1545 und 1547) und
auch das Erscheinungsjahr der Schobertschen Arbeit ist mit 1935 leider falsch
datiert.
Das Amt Altenburg in seiner
räumlichen Ausdehnung kann man im weitesten Sinne auf den slawischen Gau Plisni
zurückführen und mit dem späteren Bezirk um den Burgward Altenburg umreissen.
Die Orte des Pleissengaus finden wir im Zehntverzeichnis des Klosters Bosau aus
dem 12. Jahrhundert und die Orte um die Altenburger Burg in der Altenburger
Ersterwähnungsurkunde von 976. In der Mitte des 14. Jahrhunderts kann man schon
vom Amt Altenburg sprechen. Das wettinische Amt löste die Burgvogtei ab,
geregelt wurde alles durch die Landesordnungen. Innerhalb des Amtes als
Verwaltungseinheit werden durch die Beamten Gesetzlichkeiten mit
Gerichtsbarkeit durchgesetzt, so hatte das Altenburger Amt z.B. die
Obergerichtsbarkeit über 189 Orte. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts ist das Amt
Altenburg in drei sog. Reiten unterteilt, zurückzuführen auf die berittenen
Landsknechte, von denen jeder eine bestimmte Anzahl Dörfer in amtlichen
Angelegenheiten, wie z.B. Eintreiben der Steuer, zu bereiten hatte. Die
jahrhundertelange Tradition dieser drei Reiten führte u.a. auch dazu, dass die
Bewohner in den Dörfern der einzelnen Reiten nacheinander Kirmes feierten, so
dass per Gesetz im 19. Jahrhundert die daraus resultierende dreiwöchige Kirmes
auf eine Woche reduziert werden mußte. Die Beamten – Amtmann, Amtsschreiber,
Amtsschösser usw. – wurden bereits genannt, der wohl bekannteste unter den
einstigen Altenburger Amtmännern ist im Jahre 1445 Kunz von Kauffungen, welcher
dann Jahre später durch den Altenburger Prinzenraub berühmt-berüchtigt wurde.
Dass es ein Amtserbbuch in jener
Form gibt, wie es überliefert ist und von Hans Schobert ausgewertet werden
konnte, ist eigentlich ein Resultat der Reformation. Wie kann der Autor zu
dieser Behauptung kommen? Auftraggeber des Erbbuches war Kurfürst Moritz von
Sachsen, seine Truppen hatten 1547 im Verlauf des Schmalkaldischen Krieges
Altenburg besetzt und er behielt das Amt Altenburg bis zum Abschluß des
Naumburger Vertrages 1554. Durch die Niederlage des Schmalkaldischen Bundes
gegen den katholischen Kaiser Karl V. in der Schlacht bei Mühlberg1547, die
Gefangennahme des ernestinischen Kurfürsten Johann Friedrich des Großmütigen
und den Wittenberger Vertrag wurden die Machtverhältnisse in Mitteldeutschland
neu geordnet. Der auf Seiten des Kaisers gegen die Reformation kämpfende
albertinische Herzog Moritz, Neffe des gefangenen Ernestiners, wurde neuer
Kurfürst von Sachsen und erhielt damit auch Altenburg. Im Zuge seiner Staatsreform
ließ er noch 1547 beginnen, Amtserbbücher nach einheitlichen Plänen anzulegen –
„eine umfassende Verzeichnung allen liegenden Gutes des Landesherrn und aller
landesfürstlichen Gerechtsame“. Die Amtserbbücher geben „Aufschluß über die
ländlichen Ortschaften, Größe und Grenzen der Fluren, Hufenzahl,
Gerichtsbarkeit, die Ansässigen mit Namen und Besitz, die Gefälle und Dienste,
die Güter und ihre Bewirtschaftung, die Städte, Ritterdienste und Pfarreien.“
Heimatgeschichtlich wichtige und interessante Fakten aus den seinerzeit
angefertigten 38 von insgesamt 53 Amtserbbüchern sind von sächsischer Seite aus
heute online unter Repertorium Saxonicum abrufbar, das unser Altenburger Land
betreffende Amtserbbuch fand dabei jedoch keine Berücksichtigung. Insofern sind
die Altenburger Heimatforscher auf Arbeiten, wie jene von Hans Schobert
angewiesen, oder machen sich auf den Weg ins Sächsische Hauptstaatsarchiv nach
Dresden.
Der Historiker Andre Thieme,
welcher übrigens 2001 das Buch „Die Burggrafschaft Altenburg – Studien zu Amt
und Herrschaft im Übergang vom hohen zum späten Mittelalter“ veröffentlichte
und schon mehrfach in Altenburg mit interessanten Vorträgen präsent war,
schrieb im Rahmen des sächsischen Digitalisierungsprogramms über die Bedeutung
der Amtserbbücher: „Nichts weniger als die (vor allem) ländliche Welt des
Kurfürstentums ersteht in ihrer Komplexität und Differenziertheit, in ihren
herrschaftlichen, sozialen, verfassungsrechtlichen und wirtschaftlichen
Gegebenheiten. Durch ihre Tiefe, ihre Schärfe und ihre räumlich ausgreifende
Umfänglichkeit erweisen sich die Amtserbbücher als eine zentrale Quelle ihrer
Zeit, als Schlüssel zur Beantwortung vielfältigster Fragen. In bemerkenswerter
Weise stehen diese Amtserbbücher zeitlich, inhaltlich und formal als Mittler
zwischen Mittelalter und Neuzeit und illustrieren damit einmal mehr einen
entscheidenden weltgeschichtlichen Prozeß in seiner regionalen Ausprägung.“
Davon ausgehend und in Verbindung mit der Auswertung der Amtsrechnungen jener
Zeit hat der seinerzeitige Pfarrer in Flemmingen, Hans Schobert, mit seiner
Doktorarbeit schon 1925 einen Meilenstein der Altenburger
Heimatgeschichtsforschung gesetzt.
Quellennachweis beim Autor.
Andreas Klöppel (Mai 2017)
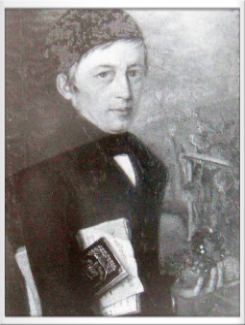
Friedrich Wagner
1792-1859
August Friedrich Karl Wagner
wurde am 9. Dezember 1792 als Sohn des Herzoglichen Obersteuerrates Friedrich
Wagner in Altenburg geboren. Am hiesigen Friedrichsgymnasium absolvierte er
seine schulische Laufbahn, um anschließend ab 1813 in Jena und Leipzig, nach
anderen Quellen auch in Heidelberg zu studieren. Nach dem Studium trat
Friedrich Wagner 1816 als Akzessist
(Anwärter für den Verwaltungsdienst) seinen Dienst in der Altenburger
Obersteuerkanzlei an. 1818 wurde er bereits Obersteuerrevisor. Seine Heirat war
1822. 1838 wurde Wagner Regierungsrat im Obersteuerkollegium und 1855 Geheimer
Regierungs- und Finanzrat im Finanzkollegium des Herzogtums Sachsen-Altenburg.
Am 4. März 1859 starb er hier in Altenburg. Soweit zunächst die kurzgefassten
biographischen Daten.
1817 ist der vielseitig
interessierte Friedrich Wagner Mitbegründer der Naturforschenden Gesellschaft
des Osterlandes, für welche er Artikel in den „Mitteilungen aus dem Osterlande“
verfasste. Von 1837 bis 1838 ist er Direktor der Pomologischen Gesellschaft,
1839 bis 1840 Erster Vorsteher des Altenburger Kunst- und Handwerksvereins.
Zudem ist er Mitglied der Altenburger literarischen Gesellschaft.
Was die Heimatgeschichte
betrifft, wird 1827 sein erstes Buch veröffentlicht: „Chronik der Herzogl.
Residenz- und Hauptstadt Altenburg vom Jahre 1801 bis zum Jahre 1825, nach
amtlichen Nachrichten bearbeitet.“ Es ist der erste Teil, welcher die
Ereignisse bis zum Jahre 1813 umfasst und damit eine der wichtigsten gedruckten
Quellen, wenn es um die Zeit der Napoleonischen Besetzung und der
Befreiungskriege geht. Der zweite Teil, umfassend die Jahre 1814 bis 1820, wird
im 4. Heft des 10. Bandes der „Mitteilungen der Geschichts- und
Altertumsforschenden Gesellschaft“ (1895) abgedruckt, deren Stiftungsmitglied
Wagner im Jahre 1838 ist und in welcher er leitende Funktionen inne hatte. In
den Jahrgängen 1834 bis 1841 des Herzoglich Sachsen-Altenburgischen
Hauskalenders erscheinen insgesamt 6 Teile einer „Übersicht über das Herzogtum
Altenburg“, verfasst von Friedrich Wagner. Zwischen 1840 und 1859 hält Wagner
160 kleinere und größere Vorträge auf den Veranstaltungen der Geschichts- und
Altertumsforschenden Gesellschaft, in deren Mitteilungsheften kommen 34
heimatgeschichtliche Themen bearbeitende Artikel aus seiner Feder zum Abdruck.
Sein Hauptwerk sind und bleiben
die „Collectanea zur Geschichte des Herzogtums Altenburg“, welche sich heute,
restauriert Dank freundlicher Unterstützung der EWA zur Nutzung im hiesigen
Staatsarchiv Altenburg befinden. Für die 30 Bände (2 wurden erst nach seinem
Tode zusammengestellt), welche vor allem Abschriften und Regesten von Urkunden
enthalten, besuchte Wagner eine große Anzahl hiesiger und auswärtiger Archive:
das Archiv der Herzoglichen Landesregierung, der Herzoglichen Kammer, das
Herzogliche Geheime Archiv, das Altenburger Ratsarchiv, das Schmöllner
Pfarrarchiv, Rats- und andere Archive in Schmölln, Orlamünde, Eisenberg, Kahla,
Stadtroda und Ronneburg, das von der Gabelentzsche Hausarchiv, das
Hauptstaatsarchiv in Dresden und das Archiv des Hochstiftes Merseburg. Auch
wenn die Forschung durch die Nutzung weiterer Archive fortgeschritten ist,
bleiben die Collektaneen ein „unentbehrliches Hilfsmittel der Altenburger
Stadt- und Landesgeschichte, das den Weg zu den Quellen selbst nicht
überflüssig macht, wohl aber ebnet“, mithin „eine reiche Fundgrube für die
Osterländische Geschichtsforschung.“ Der frühere Archivdirektor Dr. Burkhardt
in Weimar hat zur besseren Nutzbarkeit der Collectaneen ein ausführliches
alphabetisches Namensregister angefertigt. Mehr Informationen über Wagner und
seine Collectaneen findet man in der „Festschrift zum 100jährigen Bestehen der
Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg“
aus dem Jahre 1938. Einen Nachruf auf Friedrich Wagner gab es bereits im Band 5
der „Mitteilungen“ 1859 und unter der Überschrift „Lebensbilder Altenburger
Landsleute“ findet sich 50 Jahre später in der Sonntagsbeilage der Altenburger
Zeitung: „Am häuslichen Herd“ des Jahrgangs 1909 auf Seite 39 ein solches vom
osterländischen Geschichtsforscher Friedrich Wagner.
Abbildung: Repro eines Gemäldes von Friedrich Wagner, Quelle: GAGO
Quellennachweis beim Autor.
Andreas Klöppel (Oktober 2017)