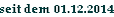Hans Schobert - GAGO
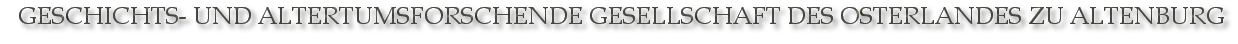

LAND & LEUTE > PERSÖNLICHKEITEN
Persönlichkeiten des Altenburger Landes
Hans Schobert
1883-1938
Hans Schobert wurde am 24.
Oktober 1883 in Gößnitz geboren, er ist der Sohn des damaligen Gößnitzer
Postmeisters. Seine Reifeprüfung bestand er 1904 auf dem Leipziger König
Albert-Gymnasium. Danach ging er zunächst nach Bonn, um sein Theologie- und
Philosophie-Studium zu beginnen, welches er in Leipzig fortsetzte und 1910 dort
abschloss. Seine theologischen Prüfungen bestand Hans Schobert 1911 und 1912 in
Leipzig und Altenburg. Im August 1913 heiratete er und trat im Oktober d. J.
die Stelle als Pastor in Schmölln an, 1917 wurde er Pfarrer in Flemmingen. Er
blieb im Altenburger Land bis 1928, wo er von Flemmingen aus ins Sächsische ging,
wahrscheinlich nach Leipzig, wo sich für den Autoren die Spuren verlieren.
Lediglich das Sterbejahr – 1938 – konnte der Autor über das Pfarrerbuch Sachsen
online erfahren.
Sein Interesse für die Geschichte
führte zu entsprechenden Studien, welche er 1923 mit einer Dissertation über
„Die innerkirchlichen Zustände Spaniens am Anfang des 4. Jahrhunderts nach den
Canones der Synode von Elvira dargestellt, erläutert und beurteilt“ an der
Hohen theologischen Fakultät Leipzig abschloss. Danach erfüllte er sich den
langgehegten Wunsch, sich mit Archivalien zur Geschichte der engeren Heimat
Altenburg zu beschäftigen. Seine Forschungen in den Staatsarchiven Altenburg,
Dresden und Weimar gipfelten in einer Dissertation zur Erlangung der
Doktorwürde an der Hohen philosophischen Fakultät der Universität Leipzig. Die
1925 von Hans Schobert vorgelegte Arbeit wurde leider nie gedruckt, ist nur als
maschinenschriftliches Exemplar überliefert und wohl auch deshalb von der
jüngeren Geschichtsforschung zu Unrecht viel zu wenig beachtet. Das Thema der
Dissertation lautet: „Das kursächsische Amt Altenburg nach einem Erbbuch von
1548 und den Amtsrechnungen von 1537 – 46“.
Zunächst möchte der Autor auf den
Inhalt des 137seitigen Werkes eingehen: In der Einleitung beschreibt Schober
seine verwendeten Quellen, als das Amtserbbuch und die Amtsrechnungen, dann die
räumliche Ausdehnung des Altenburger Amtes in der Mitte des 16. Jahrhunderts.
Der folgende erste Teil beschäftigt sich mit dem Verwaltungspersonal – Amtmann,
Schosser, Schreiber, Landsknechte, Hofmeister, Geleitseinnehmer und
Förster, dem amtlichen Rechnungswesen
sowie den Einnahmen und Ausgaben des Amtes, z.B. aus dem Geleit, dem
Eigenbesitz wie Forst, Teiche und Vorwerke, dem Gerichtsbetrieb, der Lehnware,
dem Geschoss und den Zinsen sowie bei den Ausgaben u.a. dem Haushalt auf dem
Schloss. Der zweite Teil der Arbeit beinhaltet Probleme der Amtsverfassung: 1) die
Grund- und Lehnsherrschaften im Amt (geistlich, ritterlich, amtlich) und deren
Verteilung in den einzelnen Orten, 2) die grund- und lehnsherrlichen Rechte wie
Lehnware, Zinsen und Frondienste, 3) die gerichtsherrlichen Rechte als Ober-
und Erbgerichtbarkeit in Dorf und Flur und die Organisation des ländlichen
Gerichtswesens, wie z.B. das Dorfrichteramt und der Dingstuhl, 4) die
landesherrlichen Rechte wie Steuer und militärisches Aufgebot und 5) die
ländliche Kirchenorganisation, dabei die Parochialverfassung und das Einkommen
der Pfarrer. Als eine der wichtigen Quellen wurde die Arbeit Schoberts von der
Historikerin Brigitte Streich für ihr Buch „Das Amt Altenburg im 15.
Jahrhundert“ (2000) verwendet, wobei ihr bei der Quellenangabe mehrfach falsche
Jahreszahlen für das Amtserbbuch 1548 unterkommen (1542, 1545 und 1547) und
auch das Erscheinungsjahr der Schobertschen Arbeit ist mit 1935 leider falsch
datiert.
Das Amt Altenburg in seiner
räumlichen Ausdehnung kann man im weitesten Sinne auf den slawischen Gau Plisni
zurückführen und mit dem späteren Bezirk um den Burgward Altenburg umreissen.
Die Orte des Pleissengaus finden wir im Zehntverzeichnis des Klosters Bosau aus
dem 12. Jahrhundert und die Orte um die Altenburger Burg in der Altenburger
Ersterwähnungsurkunde von 976. In der Mitte des 14. Jahrhunderts kann man schon
vom Amt Altenburg sprechen. Das wettinische Amt löste die Burgvogtei ab,
geregelt wurde alles durch die Landesordnungen. Innerhalb des Amtes als
Verwaltungseinheit werden durch die Beamten Gesetzlichkeiten mit
Gerichtsbarkeit durchgesetzt, so hatte das Altenburger Amt z.B. die
Obergerichtsbarkeit über 189 Orte. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts ist das Amt
Altenburg in drei sog. Reiten unterteilt, zurückzuführen auf die berittenen
Landsknechte, von denen jeder eine bestimmte Anzahl Dörfer in amtlichen
Angelegenheiten, wie z.B. Eintreiben der Steuer, zu bereiten hatte. Die
jahrhundertelange Tradition dieser drei Reiten führte u.a. auch dazu, dass die
Bewohner in den Dörfern der einzelnen Reiten nacheinander Kirmes feierten, so
dass per Gesetz im 19. Jahrhundert die daraus resultierende dreiwöchige Kirmes
auf eine Woche reduziert werden mußte. Die Beamten – Amtmann, Amtsschreiber,
Amtsschösser usw. – wurden bereits genannt, der wohl bekannteste unter den
einstigen Altenburger Amtmännern ist im Jahre 1445 Kunz von Kauffungen, welcher
dann Jahre später durch den Altenburger Prinzenraub berühmt-berüchtigt wurde.
Dass es ein Amtserbbuch in jener
Form gibt, wie es überliefert ist und von Hans Schobert ausgewertet werden
konnte, ist eigentlich ein Resultat der Reformation. Wie kann der Autor zu
dieser Behauptung kommen? Auftraggeber des Erbbuches war Kurfürst Moritz von
Sachsen, seine Truppen hatten 1547 im Verlauf des Schmalkaldischen Krieges
Altenburg besetzt und er behielt das Amt Altenburg bis zum Abschluß des
Naumburger Vertrages 1554. Durch die Niederlage des Schmalkaldischen Bundes
gegen den katholischen Kaiser Karl V. in der Schlacht bei Mühlberg1547, die
Gefangennahme des ernestinischen Kurfürsten Johann Friedrich des Großmütigen
und den Wittenberger Vertrag wurden die Machtverhältnisse in Mitteldeutschland
neu geordnet. Der auf Seiten des Kaisers gegen die Reformation kämpfende
albertinische Herzog Moritz, Neffe des gefangenen Ernestiners, wurde neuer
Kurfürst von Sachsen und erhielt damit auch Altenburg. Im Zuge seiner Staatsreform
ließ er noch 1547 beginnen, Amtserbbücher nach einheitlichen Plänen anzulegen –
„eine umfassende Verzeichnung allen liegenden Gutes des Landesherrn und aller
landesfürstlichen Gerechtsame“. Die Amtserbbücher geben „Aufschluß über die
ländlichen Ortschaften, Größe und Grenzen der Fluren, Hufenzahl,
Gerichtsbarkeit, die Ansässigen mit Namen und Besitz, die Gefälle und Dienste,
die Güter und ihre Bewirtschaftung, die Städte, Ritterdienste und Pfarreien.“
Heimatgeschichtlich wichtige und interessante Fakten aus den seinerzeit
angefertigten 38 von insgesamt 53 Amtserbbüchern sind von sächsischer Seite aus
heute online unter Repertorium Saxonicum abrufbar, das unser Altenburger Land
betreffende Amtserbbuch fand dabei jedoch keine Berücksichtigung. Insofern sind
die Altenburger Heimatforscher auf Arbeiten, wie jene von Hans Schobert
angewiesen, oder machen sich auf den Weg ins Sächsische Hauptstaatsarchiv nach
Dresden.
Der Historiker Andre Thieme,
welcher übrigens 2001 das Buch „Die Burggrafschaft Altenburg – Studien zu Amt
und Herrschaft im Übergang vom hohen zum späten Mittelalter“ veröffentlichte
und schon mehrfach in Altenburg mit interessanten Vorträgen präsent war,
schrieb im Rahmen des sächsischen Digitalisierungsprogramms über die Bedeutung
der Amtserbbücher: „Nichts weniger als die (vor allem) ländliche Welt des
Kurfürstentums ersteht in ihrer Komplexität und Differenziertheit, in ihren
herrschaftlichen, sozialen, verfassungsrechtlichen und wirtschaftlichen
Gegebenheiten. Durch ihre Tiefe, ihre Schärfe und ihre räumlich ausgreifende
Umfänglichkeit erweisen sich die Amtserbbücher als eine zentrale Quelle ihrer
Zeit, als Schlüssel zur Beantwortung vielfältigster Fragen. In bemerkenswerter
Weise stehen diese Amtserbbücher zeitlich, inhaltlich und formal als Mittler
zwischen Mittelalter und Neuzeit und illustrieren damit einmal mehr einen
entscheidenden weltgeschichtlichen Prozeß in seiner regionalen Ausprägung.“
Davon ausgehend und in Verbindung mit der Auswertung der Amtsrechnungen jener
Zeit hat der seinerzeitige Pfarrer in Flemmingen, Hans Schobert, mit seiner
Doktorarbeit schon 1925 einen Meilenstein der Altenburger
Heimatgeschichtsforschung gesetzt.
Quellennachweis beim Autor.
Andreas Klöppel (Mai 2017)